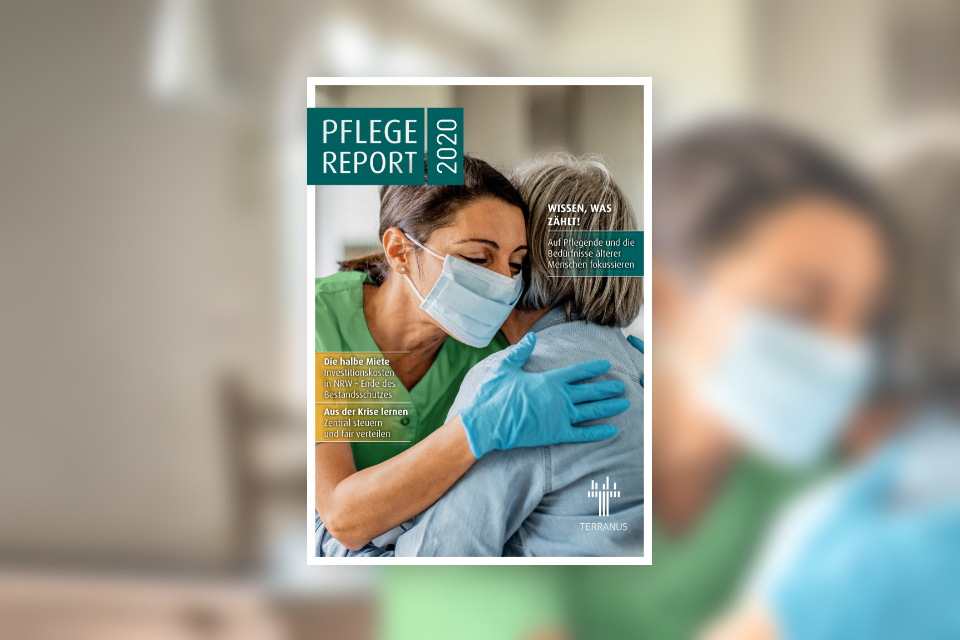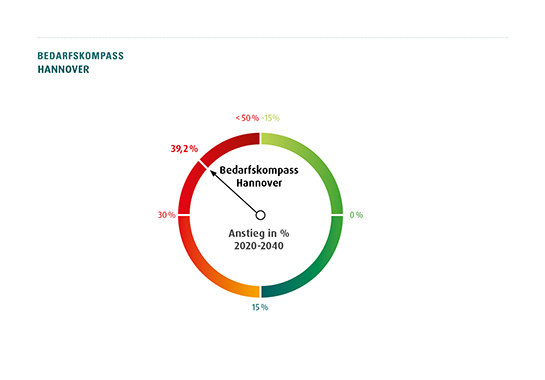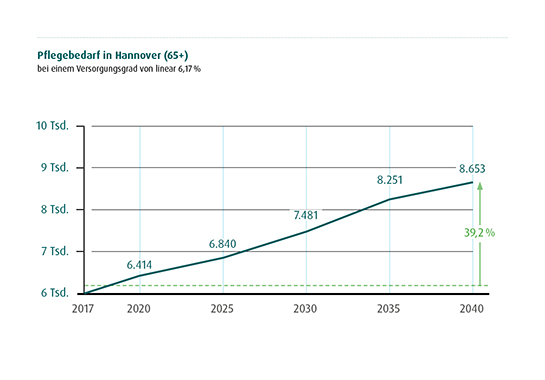Herausforderungen meistern: Zwischen COVID-19-Entlastungsgesetz, KfW-Krediten, Sofort- und Staatshilfen, der Abmilderung des Insolvenzrechts und Kreditverträgen stellen sich für Pflegeheimbetreiber vielfältige Fragen, um den Geschäftsbetrieb aufrecht zu halten und die Wirtschaftlichkeit auch nach der Krise zu sichern!

Die Corona-Epidemie fordert das Krisenmanagement der Betreiber auf allen Ebenen. In den meisten Einrichtungen herrscht Ausnahmezustand: Nicht nur pflegebedürftige Menschen sind gefährdet, sondern auch Mitarbeiter können sich nur unzureichend schützen und fallen bei Symptomen aus.
„In der aktuellen Situation gilt es zunächst, den Überblick zu bewahren und Kapazitäten in der Verwaltung vorzuhalten“, erklärt TERRANUS-Geschäftsführer Markus Bienentreu, „denn neben dem Schutz der Bewohner und Mitarbeiter sehen sich Betreiber mit einer dynamischen Situation konfrontiert, mit Aufnahmeverboten oder -beschränkungen, verwaisten Tagespflegen, dem Mangel an Schutzmaterial und vielem mehr. Das kann, möglicherweise auch zeitversetzt, erheblichen Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit der Einrichtung haben. Um die Liquidität sicherzustellen, benötigen Betreiber einen tagesaktuellen Überblick möglicher Stützungs- und Ausgleichsmaßnahmen des Rettungsschirms und deren konkreter Umsetzung.“
So kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier erst zu Beginn dieser Woche für die sogenannten KfW-Schnellkredite an, dass der Staat bis zu einer maximalen Höhe von 800.000 Euro jetzt 100 Prozent der Kreditrisiken trägt und deren Laufzeit auf 10 Jahre erhöht werde. Dass Kredite zurückgezahlt und nicht mit „verlorenen“ Zuschüssen gleichzusetzen sind, muss dabei allen bewusst sein.
Ein Überblick: Staatliche Rettungsinstrumente und bestehende Kreditverträge
Um die Stützungs- und Ausgleichsmaßnahmen in vollem Umfang zur Liquiditätssicherung zu nutzen, gilt es, einen Überblick über die verschiedenen Mittel zu verschaffen also, ob es sich um Zuschüsse oder Kredite handelt, um Ausgleichszahlungen für Corona-bedingte Mehrausgaben oder Mindereinnahmen aufgrund des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes
(§ 150 SGB XI) oder um die Abmilderung der Corona-Folgen im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht. Eine besondere Brisanz für die Liquidität in Corona-Zeiten stellen zudem Finanzkennzahlen in laufenden Kreditverträgen dar, deren Verletzung bei einer Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse ein Kündigungsrecht des Kreditgebers bzw. Fälligstellung, Auszahlungssperren oder Nachbesicherungen begründen kann und damit unmittelbar die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens bedrohen. Der TERRANUS-Überblick im Einzelnen:
Auswirkung der Corona-Krise auf Kreditfinanzierungen
Zahlreiche Unternehmen investierten in der Vergangenheit erheblich in die Modernisierung und den Ausbau ihrer Betriebe, zum einen wegen der enorm steigenden Nachfrage nach Pflegeplätzen und gewachsener Komfortansprüche der Bewohner, zum anderen aufgrund regulatorischer Vorgaben der jeweiligen Landesheimgesetze. Eine Vielzahl der laufenden Darlehnsverträge enthalten Finanzkennzahlen, die dem Kreditgeber als klassisches Frühwarnsystem für die wirtschaftliche Situation des Darlehnsnehmers dienen. Die Einhaltung der Finanzkennzahlen wird üblicherweise pro Quartal auf einer rollierenden Zwölfmonatsbasis getestet.
Kommt es nun in der Corona-Krise aufgrund möglicher Aufnahmestopps oder vorübergehender Schließungen von Teilbereichen oder Einrichtungen zu erheblich geringeren Einnahmen, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen diese wesentlich nachteilige Veränderung auf bestehende Kreditverträge und die Kapitaldienstfähigkeit hat. Eine allgemeine Regelung zu Aussetzung der vertraglichen Vereinbarung bei Pandemien oder Fällen höherer Gewalt gibt es in der Regel nicht.
Ausschlaggebend für die konkreten Folgen ist der jeweilige Kreditvertrag. Je nach Vereinbarung löst die Verletzung der Finanzkennzahlen ein Kündigungsrecht aus, führt zu Zinserhöhung oder zu Beschränkungen wie etwa Ausschüttungssperren oder der Pflicht, weitere Sicherheiten zu stellen. „Um die harten Folgen eines Bruchs der Finanzkennzahlen inmitten der Corona-Krise zu vermeiden“, erklärt Markus Bienentreu, „sollten die Unternehmen frühzeitig das Gespräch mit den Darlehensgebern suchen, transparent über die aktuelle Situation informieren sowie über den Verzicht der Ausübung des Kündigungsrechts, Aussetzung der Finanzkennzahlen oder die Anpassung des Kreditvertrags verhandeln.“
Denn für den Kreditgeber sollte es von Interesse sein, einem dem Grunde nach gesunden Unternehmen im auch künftig kräftig wachsenden Pflegemarkt kreditnehmerfreundliche Bedingungen zu gewähren. Für die Liquidität der Betreiber jedenfalls wäre es fatal, wenn aufgrund der oben geschilderten Umstände in der Zeit der Corona-Krise die Mittel aus noch nicht abgerufenen Kreditzusagen oder laufende Ziehungen aus revolvierenden Kreditfazilitäten nicht mehr zur Verfügung stünden.
Aussetzung der Insolvenzantragspflicht für Geschäftsführer
Um eine Insolvenzwelle bei Unternehmen zu vermeiden, setzt die Bundesregierung die Insolvenzantragspflicht für von der Corona-Pandemie betroffene Betriebe bis zum 30. September aus (COVInsAG). Je nach Lage der COVID-19-Entwicklung kann das Gesetz bis zum 31. März 2021 verlängert werden. Voraussetzung ist, dass das Unternehmen am 31.12.2019 zahlungsfähig war, die Überschuldung aus der Pandemie resultiert und Aussicht auf eine erfolgreiche Sanierung besteht. Daraus folgt auch für Geschäftsführer von Pflegeeinrichtungen, dass sie während des Aussetzungszeitraums alle Geschäftsführungsaufgaben im ordnungsgemäßen Geschäftsgang gewissenhaft tätigen, die zur Aufrechterhaltung oder Wiederaufnahme dienen.
Zudem werden neue Finanzierungen vorübergehend erleichtert, da sie nicht als gläubigerbenachteiligende oder sittenwidrige Beiträge zu einer Insolvenzverschleppung anzusehen sind. Eine vorübergehende Einschränkung der Anfechtungsrechte soll ferner das Risiko bestehender Vertragspartner und Lieferanten reduzieren, sodass ihre Ansprüche aus Leistungen in einem etwaigen Insolvenzverfahren nicht untergehen.
Mag die Regelung zunächst auch für Entlastung sorgen, halten Insolvenzexperten sie dennoch für hochgefährlich. Denn grundsätzlich haften Unternehmen und deren Geschäftsleiter weiter für jede Zahlungs- und Leistungsverpflichtung gegenüber Kunden und Lieferanten, die sie neu eingehen. Das schließt auch die Verpflichtung von Lohnzahlungen an Mitarbeiter ein. „Um nach der Corona-Krise nicht einer enormen finanziellen Last oder gar rechtlichen Risiken gegenüber zu stehen, erscheint es viel sinnvoller, vorrangig die von der Bundesregierung speziell für Pflegeheime und die Sicherung der Versorgung pflegebedürftiger Menschen bereitgestellten Mittel auszuschöpfen“, empfiehlt Markus Bienentreu. Geraten Unternehmen dennoch in finanzielle Engpässe, sollten sie sich vor Inanspruchnahme der neuen Insolvenz-Regelung eingehend rechtlich beraten lassen, was dieser Beitrag nicht leisten kann.
KfW-Schnellkredite zur Liquiditätssicherung
Unter der Voraussetzung, dass ein mittelständisches Unternehmen im Jahr 2019 oder im Durchschnitt der letzten drei Jahre einen Gewinn ausgewiesen hat, werden sogenannte „Sofortkredite“ gewährt. Das Volumen beträgt pro Unternehmen bis zu drei Monatsumsätze des Jahres 2019, jedoch maximal 800.000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl über 50 und maximal 500.000 Euro für Betriebe mit 10 bis 50 Mitarbeitern (Vollzeitäquivalente). Allerdings darf die Gesellschaft nicht bereits zum 31. Dezember 2019 in Schwierigkeiten gewesen sein. Für den Kredit mit einer Laufzeit von 10 Jahren und einem Zinssatz von aktuell 3 Prozent erhält die Geschäftsbank des Betriebes eine 100-prozentige Haftungsfreistellung durch die Bundesregierung. Da die Bewilligung ohne weitere Risikoprüfung mit Hilfe der Bank oder der KfW erfolgt, stehen die Mittel, so der Bundeswirtschaftsminister, schnell zu Verfügung. Das jedenfalls ist der Stand zu Ostern, allerdings ändern sich die Regelungen zu den KfW-Schnellkrediten und deren konkrete Umsetzung durch die Banken beinahe täglich.
Entschädigungsleistung für Pflegeheime auf Basis des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes
Mit Einführung der Kostenerstattungsregelung (§ 150 Abs. 2 und 3 SGB XI) können Pflegeeinrichtungen die Erstattung Corona-bedingter außerordentlicher Mehrkosten oder Mindereinnahmen bei den zuständigen Pflegekassen geltend machen. Sukzessive werden dazu in diesen Tagen Listen und Formulare der einzelnen Pflegekassen mittels Führung des GKV-Spitzenverbands veröffentlicht. Unter die Mehrkosten fallen erhöhte Ausgaben für Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel. Aufwendungen für zusätzliche Pflegekräfte – etwa wegen der Mehrarbeit für Quarantänemaßnahmen – fallen ebenso darunter. Das bezieht sich sowohl auf Neueinstellungen und Leiharbeitskräfte als auch auf die Mehrarbeit des Stammteams.
Mindereinnahmen entstehen beispielsweise, wenn aufgrund bestehender Quarantäne keine neuen Pflegebedürftigen aufgenommen werden können oder eine temporäre Schließung erfolgt. In diesen oder vergleichbaren Konstellationen sollen anteilige Ertragsausfälle über die Pflegeversicherung ausgeglichen werden. Auch die Mindereinnahmen der Tagespflege werden mit Ausnahme der Investitionskosten übernommen. Wie unbürokratisch und zügig die Aufwendungen erstattet und an die Einrichtungen ausbezahlt werden, bleibt abzuwarten.
Um Pflegeeinrichtungen und Pflegekräfte zusätzlich zu entlasten, entschied die Bundesregierung zudem die Umstellung der Pflegebegutachtung sowie die befristete Aussetzung von Qualitätsprüfungen. Und auch von der Fachkraftquote dürfen Betriebe im Notfall abweichen.
Soforthilfen für Unternehmen mit bis zu 50 Beschäftigten
Darüber hinaus stehen Zuschüsse als Soforthilfen zur Verfügung, die je nach Bundesland unterschiedlich ausfallen. Nordrhein-Westfalen beispielsweise fördert Unternehmen die Corona bedingt wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, mit bis zu 50 Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) mit einer Einmalzahlung von 25.000 Euro. Die Soforthilfe darf auch mit den anderen Hilfspaketen kumulieren, sofern in den betroffenen Betrieben dadurch die finanzielle Notsituation nicht überkompensiert wird. Der Zuschuss muss mit der Steuererklärung 2020 eingereicht und versteuert werden.
Neben den genannten Instrumenten ermöglicht die Bundesregierung auch steuerliche Liquiditätsmaßnahmen wie die zinslose Stundung von Einkommens-, Körperschafts- und Umsatzsteuer sowie in Ausnahmen die Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen durch den GKV-Spitzenverband.
„Bei den enormen Herausforderungen, die Pflegeeinrichtungen mit ihrer systemrelevanten Infrastruktur in den kommenden Wochen und Monaten zu bewältigen haben, kommt es mehr denn je darauf an, den Dialog mit den beteiligten Institutionen zu intensivieren, die Corona-bedingten finanziellen Auswirkungen präzise zu dokumentieren“, erklärt Markus Bienentreu, „sowie die eigene Liquidität in dieser historischen Ausnahmesituation präzise zu steuern, Engpässe vorherzusehen und im Zweifel mit den Schutzpaketen abzufedern.“
Redaktionsschluss für diesen Beitrag war der 9. April, er stellt keine Rechtsberatung dar und kann die individuelle rechtliche Beratung, die die Besonderheiten des Einzelfalls und der Vertragswerke berücksichtigt, nicht ersetzen.

Sie haben Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!